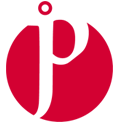Ein Rückblick aus der nahen Zukunft als
stellenweises Prosagedicht.
von Jürgen Plechinger
Wo ihr noch die Höhen fehlen, bietet die Landschaft in schamloser Offenheit ihre Einfalls- und Lieblosigkeit dar. Wie aus Achtlosigkeit zufällig hingeschmissen, lässt sie den in ihr Wandernden mit gnädiger Herablassung Leere und Geschmacklosigkeit atmen. Sie riecht nach nichts, ihre Geräusche bleiben nicht im Ohr hängen, sie kennt keine wohlklingenden Töne. Von den Menschen der letzten Generationen maßgeblich geformt, dünstet ihre Fantasielosigkeit und der Mangel an Mut und Lebenswillen aus jedem Flurstück, jedem Weg, jedem Ort.
Die einzige im Wanderer fast Fremdscham auslösende Charaktereigenschaft ist ihre Unentschiedenheit in allen Dingen, ihr Farbspektrum ist ein Klischee der lebendigen Natur, die Formen gereichen nicht einmal zu einer Parodie.
Wo ihr die Möglichkeit gegeben wäre, mit der Großzügigkeit der Weite ein Geschenk zu machen, schneidet sie sich trotz tiefsitzendem Geiz als entbehrlich missverstandenes Gehölz und Hügelkämme aus dem erdigen Fleisch, weil sie nicht wissen will, wieviel man geben kann, bevor es zuviel ist und verstellt mit dem Überflüssigen unbeholfen Sicht und Gedankengänge.
Sich ihrem völligen Fehlen an Überzeugungskraft nicht bewusst, versucht sie dem Wanderer mit nur von ihm wahrzunehmendem zwischen Verzweiflung und Unbeholfenheit wechselndem Nachdruck weiszumachen, sie hätte einen Sinn für dem Gemüt zusagende Räume, deren Gliederungen Schutz und Geborgenheit böten und unterschiedlichste Spielarten der Fantasie einlüden, sich ihrer frei zu bedienen.
Mit der Vortäuschung eines gestaltenden Willens legt sie Zeugnis ab über ihre unreife Weigerung, dem Willen den unendlichen Raum zu geben, den er zu seiner Entfaltung nötig hat.
Von ihrer verlogenen Zurückhaltung in allen Dingen des Gebens wird die sie eine die Grenzen zum Grotesken überschreitende Übertreibung des Niederen, des Nutzens in seiner trockensten, von allem lebendigen Fleisch befreiten Form.
Nach nachvollziehbaren Gründen, die Menschen bewogen haben könnten, inmitten dieser charakterlosen Langweiligkeit den Keim für einen Marktflecken zu legen, kann man ebenso vergeblich forschen, wie nach dem Bett des grünen Baches, der in Namen und Wappen des Ortes zu finden ist.
In beiden Angelegenheiten ist nichts Befriedigendes zu finden; die Suche lohnt nicht. Kleine bockige Kinder blieben einfach stehen, weil sie nicht mehr wussten, wohin es gehen sollte; das ängstigte sie und ängstigt sie noch. Dabei richtet sich ihre unreife Rebellion gegen das eigene Fortkommen.
Die Gründung jedenfalls muss auch aus Langeweile geschehen sein, aus Unlust ein Stück weiterzugehen, dahin, wo das Land höher ist und von seinen Menschen mehr verlangt, als dem nackten Nutzen zu dienen. Wenn man diesem wenigstens huldigen würde!
Man redet sich ein, Freude am Einfachen zu haben, dabei ist man nur einsilbig in im Sprechen und Denken und hat verlernt, mit Tiefe und angemessener Länge in beidem sein Menschsein zu beweisen.
Das Nichtssagende und Nichtgesagte ist bis auf das Ende eines von Süden kommenden Höhenrückens gekrochen, der den überwiegend in seinem Westen liegenden Häusern früh am Tag die wohltuend milde Sonne des Ostens nimmt und das Fundament für einen das „Hohe Schloss“ genannten Bau bildet, dessen Name seiner einzig herausragenden Eigenschaft, nämlich höher zu sein als die Häuser des Pöbels, mittlerweile Hohn spricht, da in Sichtweite jüngere, größere Gebäude erhabenere Plätze fanden.
Dennoch schafft es das hohe, unförmige Haus, sich schon aus der Ferne wichtig zu nehmen, weil es wie ein unbeholfen behauener, schmutzig-weißer Marmorblock, den ein ihm überdrüssiger Bildhauer zurückgewiesen hat, eine ihm nicht zustehende Anhöhe besetzt; ein missratenes Denkmal, dem aus Gnade oder Mitleid ein überzähliger Sockel zugewiesen wurde.
An wolkenlosen, hellen, reinen Tagen biedert es sich dem blauen Himmel an, weil es nicht wahrhaben will, dass es für einen tief verhangenen, grauen Himmel gemacht ist, an dem stürmischer Wind Wolkenfetzen über das Schloss hinweg treibt. Dann nimmt es die Gelegenheit gerne wahr, vorzugeben, es könne wenigstens mit schlechtem Wetter etwas geben, gegen das sich Trutz und Trotz lohne.
Je klarer und tiefer das Blau des Himmels ist, desto mehr wird dem aufmerksamen Betrachter das Unvermögen des Gemäuers bewusst, aus den Vorteilen der Umgebung Gewinn zu ziehen.
Ich kam als Vagabund mit dem Nordwind im Rücken in diese Gegend. Aus der Distanz, als kleiner, kantiger schmutzig-weißer Fleck vor dem Panorama des dunkelgrün bewaldeten Hügelkamms vermochte das Schloss meine Neugierde zu wecken, weil sein Unwesen nicht erkennbar war.
Nah genug herangekommen, um des Schlosses seltsame Verweigerung auszeichnender Eigenschaften wahrnehmen zu können, konnte ich bereits ahnen, dass es im darunter liegenden Ort nichts zu gewinnen gibt, was über die Erhaltung eines Stillstands hinausgeht.
Von Zeit zu Zeit singen sie sogar Lieder über Vagabunden.
Sie lachen mit ihnen, solange sie etwas erzählen, dass für sie zum Lachen ist. Dann zeigen sie sich gönnerhaft, freigiebig und lieben ihre Großzügigkeit. Sie haben ein deutliches, aber dummes Lachen und formen aus deutlichen Worten dumme Sätze. Erzählen die Vagabunden Geschichten, um sich selbst zum Lachen bringen, werden sie aus ihrer Mitte geworfen.
Obwohl geblieben, bin ich immer noch ein Vagabund. Arbeit fand ich beim Müller, meine Kunst keinen Anklang. Doch gerade weil sie keinen Anklang findet, wird sie gebraucht, weshalb sich wohl das Schicksal für mein Bleiben entschieden hat.
Karl Ochsenstirn, im Jahr 1 n. A.