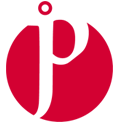Von Jürgen Plechinger
Die Galerie wurde nicht gefunden!Wer weiß, an welchen interessanten Einsichten in gewinnbringender Textgestalt man sich erfreuen könnte, hätte Friedrich Nietzsche den Heerdeninstinkt als „wesentliches primum mobile“ in seiner „Abrechnung mit der Moral“ nicht „einstweilen beiseite gelassen“.
Wesentliches dazu hat Gustave Le Bon nur wenige Jahre später in seiner Abhandlung „Die Psychologie der Massen“ nachvollziehbar dargelegt.
Silvio Gesell konnte die „Heerde“, bzw. deren oberste Schafsköpfe, nicht von banalsten Selbstverständlichkeiten, die nichts anderes als die Lösung der sozialen Frage bedeuten, überzeugen.
Von der Aussicht auf Weltfrieden und allgemeinem Wohlstand auf höchstem Niveau konnten weder die hart schuftende Masse noch die „führenden Eliten“ damals und heute überzeugt werden.
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert, deren Erreichen die Menschheit maßgeblich Arthur C. Clarke zu verdanken hat, identifizierte dieser die „Inbeschlagnahme der Moral durch die Religion“ als „größte Tragödie in der gesamten Geschichte der Menschheit“.
Bis dahin waren 2 Weltkriege und unzählige weitere Kriege über die Weltbühne gegangen und die darauf folgende atomare Abschreckung verhindert seit dem Ende der Sechziger des letzten Jahrhunderts bis heute einen dritten, der — wäre der globale Krieg als Vater aller Dinge konventionell geblieben — „nur“ der nächste in einer Reihe von bis heute fünf Weltkriegen gewesen wäre.
Die unmissverständliche Entlarvung des mindestens 1700 Jahre alten Dramas von Gut und Böse als beschämende, bitter-peinliche Farce durch Friedrich Nietzsche beweist, dass eine wie auch immer geartete, dem Menschen innewohnende Bosheit als Ursache unermesslichen, unaussprechlichen, viele Generationen geschehenen Leids eine der größten Lügen der Menschheit ist.
Das Christentum kennt die als Lösungsvorschlag gründlich missverstandene, umgewertete Erbsünde und könnte in der Folgerung, dass es eben „unabänderlich so ist, Amen!“, stehenbleiben, wenn man mit dieser Einstellung stehen bleiben könnte!
Selbstverständlich entzieht es sich der christlichen Wahrnehmung, dass sich die Welt mit diesem „Zufriedengeben“ sukzessive in die Hölle verwandelt, die der Christ zur Aufrechterhaltung seines Weltbildes und seines „Seelengleichgewichts“ nötig hat.
Weshalb also ist eine Lebensumgebung, die allein durch die Umsetzung banalster Selbstverständlichkeiten zu allgemeinem Wohlstand und dauerhaftem Weltfrieden führt, augenscheinlich nicht verwirklicht?
Annahmen, es könnte — die Entwicklung der Kultur betreffend — eine größere Macht auf Erden geben als das von C. G. Jung beschriebene kollektive Unbewusste können nach der Lektüre der Schriften der genannten Wissenschaftler, Denker und Autoren getrost ad acta gelegt werden.
Man könnte fast meinen, es wäre anzubeten wie ein Gott (diese kleine Pointe verstehen gegenwärtig vielleicht 100 Menschen auf diesem kleinen Planeten).
Jedenfalls sollte deutlich werden, dass Wissen, dass erst nach Nietzsche zugänglich war, seine Schriften in einen Zusammenhang stellen lassen, der es uns, die wir nichts als die „Décadence“ kennen, ermöglicht, sie besser— vielleicht überhaupt erst — zu verstehen.
Zudem wird dick unterstrichen, dass Nietzsche sich durchaus berechtigt als stark genug sah „die Geschichte der Menschheit in zwei Stücke zu zerbrechen.“ Als Leser kann man erahnen, in welche Gebiete man vordringen kann, wenn man sich mit diesem außergewöhnlichen Denker beschäftigt.
Das bedeutet, den Stand der Dings namens „Bild von Nietzsche“ betreffend, dass die Phase der Recherche immer noch andauert, wobei die Zitate aus den ersten Sätzen dieses Beitrags einem Brief Nietzsches aus dem vorletzten Jahr, in dem er noch Briefe schreiben konnte, entnommen sind, diese Lektüre also demnächst ein Ende findet.
Zudem ist die Arbeit, die zu diesem Projekt nötig ist, zwar eine Art Hauptsache, sie kann aber nicht DIE Hauptsache sein, weil es gegenwärtig nichts weiter zu verkaufen gibt als Körperkraft gepaart mit einigen kognitiven Fähigkeiten, also mehr oder weniger ausdauerndes Geschick.
Wobei dieses nicht unbedingt an der Nachfrage liegen muss, sondern auch am künstlerischen Angebot, das auf seine Arten dürftig ist — soviel ist verstanden worden.
Wie schrieb der hochbetagte, in ärmlichen Verhältnissen gestorbene Maler Karl Ochsenstirn in sein Tagebuch: „Der Verlauf meines Lebens ließ mich frühzeitig die Nachfrage aus meinem Erwartungsrepertoire streichen.“
So kann man arbeiten! Genauer: Sich ausdenken zu müssen, was sich die „Décadence“ an die Wand hängen, drucken oder als gestalterisches Verkaufsvehikel erniedrigen will, hat die Überwindung eines gewissen Weltekels nötig, die nur gegen den allergrößten, aufrichtigem Widerwillen zu bewerkstelligen wäre.
Das bedeutet keinesfalls eine Entmutigung. In jungen Jahren notiert Ochsenstirn am Rand einer Studie: „Und wenn das Kunstfertige in der Beharrlichkeit liegt: Auch gut! – Vielleicht ist das die konsequenteste ihrer Ausprägungen.“
Daran hätte Nietzsche vielleicht Gefallen gefunden.