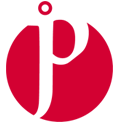Ein Boxerasket und die Ästhetik radikaler Kleinzustände
„Zu spät zu erkennen, von bestimmten Vorhaben die Finger zu lassen, weil man sich und sein Potenzial heillos überschätzt, ist, angesichts der Jahrzehnte, die man rückblickend damit vergeudet hat, schmerzhaft. Die eigene Sturheit zu kultivieren, indem man sich selbst seine Uneinsichtigkeit als Beharrlichkeit verkauft, funktioniert jedenfalls nicht auf Dauer und erst recht nicht kontinuierlich. Obligatorische Schamgefühle, zeitweise zu Todessehnsüchten führend, sind in der Folge unausweichlich mitgestaltend, was aber nicht als Generalausrede für Unfähigkeit verstanden sein will. Es ist der Versuch einer Erklärung des steten, unausweichlichen Nichtgelingens ‒ meines Nichtgelingens, oder besser: meines Nicht-Gelungen-Seins.“
Er muss mit einem (laut Selbstauskunft auch ihm selbst unerklärlichen), rätselhaften, ewigen Makel behaftet sein, wodurch folglich seine Wahrnehmung makelbehaftet ist. Deshalb ist auch seine „Kunst“ zwingend und unausweichlich Makulatur; weil P.s innerer Verarbeitungsprozess, der Weg vom Sehen zum abgeschlossenen (aber nicht zwingend vollendeten) Endergebnis in einem fehlerhaften Prozess entsteht. Es handelt sich insofern um einen Fehler, als er eine Abweichung von der sogenannten Norm beschreibt, eine außerordentliche Abwegigkeit.
„Mir ist sehr wohl bewusst, dass meine Wahrnehmung einer Norm und die Radikalität, in der ich die Abwegigkeiten meiner dem Bild vorausgehenden und begleitenden Denkprozesse wahrnehme, subjektiv sind. Aber auch diese Einsicht führt nicht dazu, dass ich einen erlösenden Ausweg finde.“
Everything he touches turns into crap. Glaubte man an die Wirksamkeit von Verwünschungen, würde man ihn einen Verfluchten nennen. Viel geeigneter beschreibt man ihn dagegen als Gefangenen, der in sich nicht die Gabe zu aktivieren weiß, in Ketten tanzen zu können. Sein Kerker erscheint ihm als Mutlosigkeit und Unkenntnis seiner selbst, gegen die er nur ein probates Mittel zu haben scheint: Verweigerung.
Aus diesem Gefängnis entkäme er durch Nachäffung, Anpassung an einen (Massen)Geschmack, der auf dem Berg von Unrat ärmlicher, unreifer Vorstellungen von Zeitgeistern vor sich hin kümmert und damit zufrieden ist, als Hauptnährstoffe Unlauterkeit, und Niedertracht zu bekommen. Er müsste kapitulieren und sich verleugnen, indem er die sich selbst gestellten gestalterischen Aufgaben angeht, wie es der gängigen Übereinkunft entspricht.
„Alles Gängige ist mir zuwider oder langweilt mich, meistens beides. Der vorschnelle Schluss, also das Urteil, das eigentlich ein Vorurteil ist, ist a priori der Faulheit verdächtig, der Unterwürfigkeit unter von Generationen von und durch Kanaillen etablierten, verlogenen und seit 1600 Jahren todlangweilig gewordenen Klischees. Wenn einem auch der geistigen Gesundheit wegen nichts hassenswert sein sollte, kann sich diese Tatsache meines Hasses sicher sein. Was die Masse der hirnlosen, unterwürfigen Langweiler selbst betrifft, bin ich so gnädig, ihnen aus dem Weg zu gehen.“
Als Person tritt P. möglichst nicht in Erscheinung, was nicht nur für ihn von Vorteil ist.
„Vorverurteilende, kleingeistige Arschlöcher sind oft deckungsgleich mit jenen, die meine Höflichkeit als Schwäche missverstehen und nur einen vermeintlich funktionierenden Instinkt haben: Jede Gelegenheit zu erkennen und zu nutzen, sich über den anderen zu stellen, weil sie sich ‒ insgeheim ‒ , denn nur so können sie sich zumindest ansatzweise erlauben, ehrlich zu sein, für kleine, erbärmliche Würstchen halten müssen. Auch wenn sie eigentlich zu bedauern wären, zöge ich es vor, dieses Gesindel im äußersten Fall einer meist verbalen Tracht Prügel zu unterziehen, sollte so ein Clown in der Verkleidung eines Normalschwachkopfs meinen Weg in einer Weise kreuzen, der mein zugegebenermaßen bescheidenes Fortkommen zu seinem Vorteil einzuschränken versucht. Mit ‚Fortkommen‘ meine ich übrigens nur eine halbwegs stressfreie Existenz in maximal möglichem Frieden und nicht irgendwie geartete karrieristische Neigungen, die bei den meisten Leuten lächerlich wirken, weil sie nur bei sehr wenigen keine Kompensation eines Mangels sind.“
Einem passionierten Boxer sollte man eben nicht dumm kommen; erst recht nicht, wenn er arm ist und somit ohnehin nichts zu verlieren hat. »He’s just a poor boy, though his story’s seldom told …« . Entscheidend ist allerdings, woran es dem armen Jungen mangelt. Weil P. materiellen Mangel und Mittellosigkeit sein Leben lang kannte, ist sein Leiden darüber kontinuierlich, also zur Gewohnheit geworden. Eine immer wieder aufflammende, akute Angst vor der Unstillbarkeit des Mangels an Anerkennung allerdings lässt ihm keine Ruhe. Dabei besteht ein erstes ironisches Momentum darin, dass er sich gleichzeitig völlig im Unklaren darüber ist, ob er einer irgendwie gearteten Anerkennung überhaupt würdig ist.
„Für Berechtigungen habe ich nicht das geringste Sensorium. Ich weiß nicht, ob ich berechtigt bin, mir Wunschbilder über mich auszumalen, die alle möglichen als gemeinhin positiv angesehenen, menschlichen Eigenschaften in jeglicher Wunschkonstellation abbilden können. Solche ‚Tugenden‘ bilden sich ja durch die Gesellschaft und sind abhängig von deren Beschaffenheit, die durch ihre generationsübergreifende Geschichte geformt wird. Positive und negative, dem Individuum zugeschriebene Eigenschaften können abhängig von Grad der Zivilisierung unterschiedlich bewertet, ja sogar vertauscht werden. Beispielsweise bin ich in dieser Welt ein Verlierer, eine gescheiterte Existenz. Für die antike Gesellschaft, die den ersten biblischen Schöpfungsmythos hervorgebracht hat, wäre ich Gewürm. Heutzutage benutzt man dieses Wort nicht mehr offen, dennoch hat man in unserem Stand der Kultur in ihrer 2000-jährigen Rückständigkeit beileibe nicht automatisch das Recht auf Würde, nur weil man existiert ‒ unabhängig davon, was irgendwann einmal gesetzlich festgelegt wurde.
Was hätte ich davon, ich für einen vorbildlichen Bessermenschen zu halten, wenn mich die ‚soziale Meinung‘ in ihrer hierarchischen Ordnung als Bodensatz der Gesellschaft ansieht? Wo beginnt dabei die Selbstleugnung? Ich habe keine Idee davon, wo ich zwischen diesen Extremen stehe. Ich weiß nicht einmal, ob meine Scham, Anerkennung für etwas zu erwarten, von dem ich nicht weiß, ob es diese verdient, berechtigt ist. Sicher ist nur, dass diese Scham real und wiederkehrend ist.“
Das zweite ironische Moment hat eine Art Zirkelschluss zur Ursache, den man fürwahr als Teufelskreis bezeichnen kann.
„Die Vorstellung, dass es schambehaftetem, unsicherem Gewürm schwerfallen muss, offensiv für sich und ihre Arbeit zu werben, dürfte plausibel sein. Das hat aber hat einen Mangel an positiver Rückmeldung zur Folge, der dieses defensive Verhalten verstärkt. Diesbezüglich besteht also eine Art negativer Rückkopplung, die aber nur die Folge besonderer Ereignisse in meinem Leben ist. Ein erstes Ereignis markiert den Beginn meiner Existenz und ich habe erst in jüngster Vergangenheit darauf schließen können. Auch ohne es im Detail zu beschreiben, kann man vorerst festhalten, dass dadurch bestimmte Ein- und Vorstellungen gesetzt wurden. Einerseits resultierten daraus erhebliche Schwierigkeiten sich in dieser Welt zurechtzufinden, aber andererseits schaffte es Möglichkeiten für Dinge aufgeschlossen zu sein, die für andere mehr oder weniger uninteressant oder abwegig, sogar undenkbar waren. Zudem ließ es mich eine hohe Sensibilität für Sinneswahrnehmungen und eine hohe Affinität zum Spiel mit der eigenen Phantasie entwickeln. Wegen des vermeintlich positiven Tenors des gerade gesagten, muss ich allerdings darauf hinweisen, dass meine Empfindsamkeit Teil meines Anfangs erwähnten ‚Fluchs‘ sein könnte, jedenfalls habe ich das größtenteils so wahrgenommen.“
Interessanterweise gibt es eine Verbindung zwischen den frühkindlichen bzw. pränatalen Erfahrungen und einem zweiten einschneidenden Ereignis, dass in seinem erwachsenen Dasein stattfand. Noch ohne das Wissen um die einschneidende frühkindliche Prägung benannte er sich in einer Art Ver- oder Bearbeitungsprozess als Autor eines sogenannten Blogs nach „Didymos Judas Thomas“, dem wohl einzig wirklich wissenden Jünger, der bemerkenswerterweise auch „der Zwilling“ genannt wird.
„Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich ein übriggebliebener Zwilling bin, dessen Geschwister in einem frühen embryonalen Stadium noch in der Gebärmutter starb. Noch bin ich in einem Eruierungs- und Erfahrungsprozess, aber es lässt sich feststellen, dass in der Regel unterbewusste, den Lebensweg gestaltende Prägungen hier ihre Ursache haben.“
Das zweite einschneidende Vorkommnis in P.s Leben markiert eigentlich den Beginn eines Prozesses, der immer noch andauert …
„… und auch bis zu meinem biologischen Ableben nicht enden wird; zumindest, was meine momentane Existenz betrifft. Das kann ich durch unmittelbares Erleben schon sicher sagen. Doch auch meine zukünftigen Inkarnationen werden davon betroffen sein, dass ich irgendwann im Jahr 2011 begann, der Weltkenntnis teilhaftig zu werden. Wenn nicht durch innere, dann sicher durch äußere Umstände. Was für das gewöhnliche Ohr ziemlich sicher völlig überdreht klingt und momentan unverständlich bleiben wird, hätte wohl jedem anderen auch schon zu diesem Zeitpunkt passieren können; inwiefern der Zufall eine Rolle spielt, soll hier nicht das Thema sein. Konsequenterweise weiß ich nicht, ob ich berechtigt bin, daraus eine besondere Befähigung abzuleiten. Ich sollte noch erwähnen, dass das Gesagte nur deshalb als geheimnisvolles Raunen eines vermeintlichen Wichtigtuers erscheinen könnte, weil an dieser Stelle nicht alle relevanten Sachverhalte zu klären sind und ich den ‚künstlerischen‘ Teil meines Lebens behandelt sehen möchte.“
Selbstverständlich lassen sich die beschriebenen Umstände nicht losgelöst von P.s Weltsicht und daraus resultierenden Bemühungen der Lebensbewältigung betrachten. In den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten wurde eine latente Allergie gegen Wichtigtuerei, Dummgeschwätz und Verlogenheit zu einer sich stetig intensivierenden geistig-emotionalen Immunreaktion. Sein ohnehin schon von Misstrauen geprägtes Verhältnis zu der ihn umgebenden Gesellschaft wuchs parallel mit seiner „Welterkenntnis“.
„Aus einer existenziellen Notwendigkeit habe ich eine Daseinsform als Asket gewählt. Allerdings verstehe ich Askese nicht in einer christlichen Sichtweise, die in Wahrheit antichristlich ist und die ursprüngliche Bedeutung des Wortes völlig pervertiert. Die dem griechischen Ursprung zu entnehmende stete Übung von oder an Körper und Geist wende ich, was den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten angeht, natürlich grundsätzlich ganz allgemein an. Dennoch kultiviere ich diese Grundhaltung besonders in der Kunst und im Boxsport. Oberflächlich mögen beide Bereiche völlig unterschiedlich, vielleicht sogar gegensätzlich erscheinen, dennoch gibt es interessante gemeinsame Aspekte. In beiden ‚Disziplinen‘ ist die Schulung des Auges von Bedeutung. Bilder und Kontrahenten muss man zu lesen wissen. Des Weiteren sind die Schmerzen des Athleten und die Enttäuschungen des Künstlers für mich dieselbe Empfindung, die sich nur in ihrer Form unterscheidet, also denselben Bedarf an Überwindung fordert. Und schließlich wohnt beidem das Potenzial tänzerischer Elemente inne. Sie bieten dadurch vielleicht ein Surrogat für Nietzsches ‚Tanz in Ketten‘. Wenn mir dieser letztlich nicht gelingt, so kann ich wenigstens in Ketten kämpfen.“
Die von P. verachteten, von ihm als „gängig“ oder „traditionell“ bezeichneten Vorstellungsmuster mögen dazu verleiten, einem Kämpfer, zumal er auch noch hart vor allem zu sich selbst ist, die bereit angedeutete Empfindsamkeit abzusprechen. Das wäre eine krasse Fehleinschätzung.
„Das gilt übrigens auch umgekehrt, wenn die Offenbarung von Empfindsamkeit als Schwäche missverstanden wird. Nebenbei bemerkt ist Empfindsamkeit eines der schönsten deutschen Wörter, wie ich finde. Nun, wie dem auch sei, für solche aus instinkthafte Reaktionen hervorgehenden Schnellschlüsse zur Aufrechterhaltung eines grotesk simplifizierten, naiven Weltbilds verwende ich den mir von Nietzsche geliehenen Begriff ‚Verwechslung‘. Eigentlich bezeichne ich damit im Allgemeinen die Gewohnheit, anderen zu unterstellen, man trachte nach den gleichen Zielen, hätte die gleichen Interessen, glaube denselben irrelevanten Scheiß zu ‚wissen‘ und handle aus ähnlichen Motiven. Kurz: Man wäre ein ebensolcher sich wichtig nehmender, erzverdummter Schwachkopf. Dieser ganze Komplex an Missverständnissen und Fehlschlüssen ist die Basis der allgemeinen Kleingeistigkeit, die den typischen Spießbürger ausmachen.“
Ein sensitiver Mensch wie P. empfindet die Erfordernisse, denen er mit Überwindung begegnen muss, ganz bestimmt besonders extrem.
„Meine Wahrnehmungen können sich sehr intensiv anfühlen. Obwohl ein Vergleich mit der Intensität der Wahrnehmungen anderer völlig sinnlos ist, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass ich Details bemerke, die anderen verborgen bleiben, weil sie keine ‚Verwendung‘ dafür haben. Ich kann mich völlig in Formen, Farben, ihren Beziehungen Verhältnissen zwischen Dingen, Vorkommnissen und unendlichen Assoziationen verlieren. Zusammenfassend nenne ich diese meine Wahrnehmungswelt zusammensetzenden Phänomene ‚radikale Kleinzustände‘. Sie sind praktisch eine ständige Quelle der Faszination an für mich höchst spannenden Wahrnehmungen. Würde ich diesbezüglich einen Einzelfall beschreiben, würde ich völliges Unverständnis ernten, weil das Gesagte völlig banal erscheint. Es könnte in Worten höchstens nur in äußerst freier Poesie ausgedrückt werden, oder in Form von Musik ‒ oder eben als Ergebnis bildender Kunst.“
Ein armer, einsamer Boxerasket in der steten Auseinandersetzung mit der Ästhetik radikaler Kleinzustände. Das wäre der wahrhaftige „Promotext“ für P.. In der (Menschen)Welt, die P. beschreibt, ist man damit praktisch nicht vorhanden.
„Vielleicht wählt noch das Schicksal für uns die Interessen und Objekte unserer Neugierde. Dennoch ist die Art, wie man die Welt betrachtet, von Einflüssen abhängig, die man bewusst oder unbewusst annehmen, erweitern und verfeinern kann. Informationen, Eindrücke, Wahrnehmungen lassen sich aber auch ignorieren oder missverstehen. Außerdem kommen noch Prägungen hinzu, die sich nicht unbedingt leicht erkennen und auflösen lassen. Wobei durchaus die Frage erlaubt ist, ob letzteres überhaupt notwendig ist. Unter diesen meist kindlichen Formierungen gibt es ja auch welche, die man als identitätsstiftend wahrnimmt. In meinem Fall gab es vielleicht in prägenden Momenten für etwas halbwegs Gelungenes übermäßiges Lob, das zum Entschluss führte, der Kunst in meinem Leben einen dermaßen großen Raum zu geben, sodass für materiell-existenzielle Bestrebungen nur noch wenig Platz übrig ist. Letztendlich ist das Bestreben des Individuums, mit den geeignetsten Mitteln das Beste für sich zu erreichen. Das ist an sich absolut nicht kritikwürdig und ich nehme es für mich selbst auch in Anspruch.
Solange aber der Mensch noch nicht den Weg zur allumfassenden Beherrschung über die Dinge beschreitet und damit Nietzsches ‚Willen zur Macht‘ seine Verwirklichung findet, gibt er sich mit der Macht über Menschen zufrieden ‒ und mit erbärmlichen Versuchen, Macht über die Umstände seines individuellen Lebens zu erlangen. Für letzteres brauche ich die Kunst. Sie ist Teil meiner Lebensbewältigungsstrategie.“
Wie man wird, was man ist (Nietzsche), und sei es auch nur für sich selbst (P.)
„Auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, mit fortschreitender Zeit der umfassenden Resignation gefährlich nahezukommen, werde ich vorerst weitermachen ‒ woanders als Anderer.“